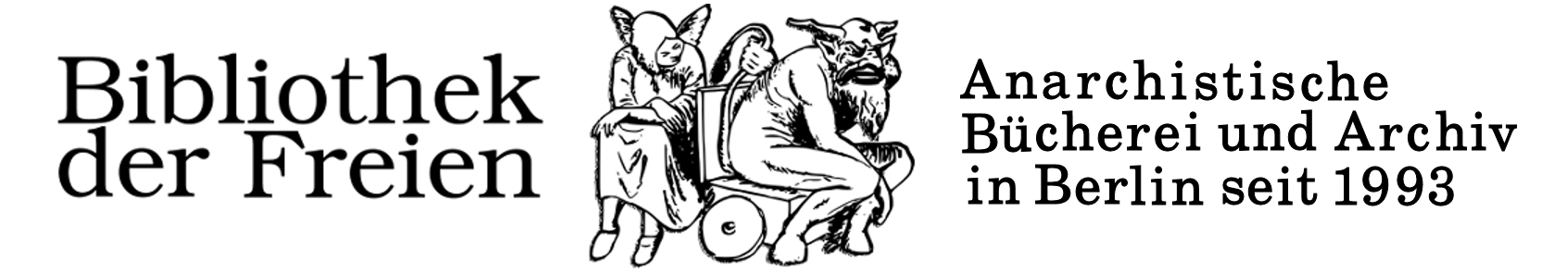– oder von der Suche nach Anarchie wo sie niemand vermutet Zur Ausstellung von Franz Schuck
Eine Veranstaltung in der Bibliothek der Freien am Freitag, 26. Mai 2006 [ Ankündigung ]
Verlorene Kunst
Verlorene Kunst oder »lost art« – wie es im Englischen heißt – ist eine feststehende Begrifflichkeit, mit der sich in Deutschland behördlich die »Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste« beschäftigt. Die Behörde in Magdeburg konzentriert sich bei ihren Recherchen oder Ermittlungen auf die Kunst, die im Zweiten Weltkrieg zerstört oder geraubt worden ist. Bekannt sind in diesem Zusammenhang die Stichworte »Beutekunst« oder »entartete Kunst«. Diese Begriffe wie die sich daraus ergebenen Fragen umrahmen in einem sehr erweiterten Sinn auch die verlorene Kunst von Franz Schuck.
Es gibt Künstler – wozu unter anderen die von der Anarchie inspirierten Situationisten [vgl. auch die Situationistische Internationale, die im Jahr 1957 in Cosio d’Arroscia in Norditalien gegründet worden ist und die sich 1972 auflöste] zählen – die stark bezweifeln würden, dass Kunst je verloren gehen kann. Für solche Künstler oder Denker bezeichnet der Begriff »Kunst« das, was Michael Bakunin unter sein berühmtes Wort von der »schaffenden Lust« gestellt hat. Eine so verstandene Kunst beansprucht absolute Präsenz in der Gegenwart. Es ist eine Kunst, die sich nicht musealisieren lässt. Die Kunst selbst soll durch ihre Verwirklichung im Leben aufgehoben werden, was bedeutet, dass künstlerisches Handeln nicht mehr nur auf Leinwänden, sondern in der Gestaltung der alltäglichen Lebenswelt stattfinden soll. In einem gewissen Sinn bedeutet es damit auch das Ende der Kunst – denn als Kategorie wäre der Begriff sinnlos, insofern er keinen speziellen Ort mehr für etwas bezeichnet, das anderswo nicht stattfindet.
Kunst im Sinne von Bakunin ruft, fordert und erinnert die Kreationsfähigkeit jedes einzelnen Menschen – unabhängig von dessen Profession oder Gestus:
»[…] die Kunst individualisiert gewissermaßen die von ihr erfassten Typen und Situationen und erinnert uns durch diese Individualitäten ohne Fleisch und Knochen, deren Schaffung in ihrer Macht liegt, […] an die lebenden, wirklichen Individualitäten, die vor unseren Augen erscheinen und vergehen.« [M. Bakunin, in: Gott und der Staat, Bd. 1 Ausgewählte Schriften, hrsg. von Wolfgang Eckhardt, Berlin 1995, S. 89].
Bakunin war kein Künstler im Sinne des Wortes, wohl aber ein tatkräftiger Lebensgestalter – »Hoffnungsschimmer und die kleinste Aussicht auf Glück trieben ihn ständig von Ort zu Ort« [Filippo Turati, 1887] – , der die Künstler-Generationen des 20. Jahrhunderts im Sinne der Glücks- und Freiheitssuche nachhaltig inspirierte [z.B. Joseph Beuys].

Die Kunst, die Franz Schuck in der hier gegebenen Ausstellung zeigt, trägt das Attribut »verloren«. Was ist unter »verloren« zu verstehen? In der ihm eigenen Reproduktion – Öl auf Asche – werden Bilder, die durch Kriege, Räubereien oder andere katastrophale Umstände zerstört worden sind oder als verschollen gelten, wieder erinnert.
s ist dieser Akt des Erinnerns, der mich am meisten fasziniert und interessiert. Es ist die Frage nach dem Warum. Die Frage nach den Lücken und Löchern, die durch die zerstörten Kunstwerke entstanden sind. Was waren die Gründe der Zerstörung? Kann durch die Reproduktion das Verlorene wieder gefunden werden? Weshalb sollen wir uns an Bilder, Kunstwerke erinnern, die heute vielfach nur unter dem Label »museal« Beachtung finden würden?
Franz Schuck versucht Betrachter und Interessierte – gerade indem er in seiner Reproduktion variiert und dabei doch seiner eigenen Technik treu bleibt – einzuladen über die dereinst entstandenen Lücken neu nachzudenken. Es steht dabei gar nicht mal das Bild als solches im Vordergrund sondern vielmehr der Akt des Erinnerns. Es ist ein Erinnern, das verstört und bewusst gegen den heute üblichen Trend der Musealisierung und Folklorisierung steht, wie er von Gottfried Korff beschrieben wird, wo
»Das Falsche echter wird als das Reale, die Imitation eigentlicher als das Original. Was entsteht, ist eine Hyper-Realität, […]. Hyper-Realität kommt dort ins Spiel, wo das Original fehlt und auf keine eigentlich historische Realität mehr rekurriert wird: Eine folkloristische Hyper-Realität wird Surrogat der historischen Wirklichkeit. Die durch den Verbund von Folklorisierung und Musealisierung evozierte Reliktversessenheit und Dingnostalgie ist zum Medium der Gegenwartsflucht, der Rückdesertion geworden. Musealisierung und Folklorisierung erwecken die Illusion eines beseelteren Daseins, einer besseren Welt […].« [Gottfried Korff, in: Aporien der Musealisierung, aus: ders., Museumsdinge, Köln 2002, S. 132f].

Franz Schuck zeigt durch seine »verlorene Kunst« keine idealisierte Welt. Bilder wie Otto Dix »Schützengraben« oder »Die Ermordung Lepelletiers« von Jacques-Louis David führen die Betrachter in Zeiten, die gern verdrängt oder vergessen werden. Andere Bilder, wie beispielsweise die »Klosterruine« nach Caspar David Friedrich, die unpolitische Motive zeigen, können stärker auf einen generellen Aspekt des Erinnerns verweisen: auf die Vergänglichkeit, die allen Dingen droht bzw. von Anfang an innewohnt. Hierbei kann Franz Schuck als ein Künstler verstanden werden, der einem Sisyphos gleich, immer wieder neu erinnert. Kein Bild kann je verloren gehen, ist die immanente These. Der Künstler malt gegen die Vergänglichkeit an. Die Bilder der »verlorenen Kunst« werden zu Felsbrocken, die immer wieder vom Künstler den Berg hinaufgerollt werden. Ob die Zuschauer, die oben auf dem Berg die Felsen erwarten, sich selbige auch im Detail ansehen werden, ist für den Künstler nebenrangig. Er malt und erinnert im Geist des Absurden – obschon er um die Vergänglichkeit weiß, will er sich mit selbiger nicht abfinden. Insofern Bilder und Kunst zu den Orten des öffentlichen Raums gehören, sind andere eingeladen, es ihm gleich zu tun. Die Bilder von Franz Schuck unter die Prämisse der Philosophie des Absurden im Sinn von Albert Camus zu fassen, eröffnet die Möglichkeit über ein grundsätzliches Motiv der Kunst nachzudenken: die Seinsbejahung, in der die Angst vor dem Nichts wohnt. Franz Schuck hat keine Angst vor dem Nichts. Im Gegenteil, seine »verlorene Kunst« ist ein seltener Versuch in der westlichen Kunstszene, sich mit dem Tod zu versöhnen, das drohende Nichts anzunehmen, sich kreativ damit auseinanderzusetzen. Ich erlaube mir eine Assoziationskette zu einem »Psalm« von Paul Celan herzustellen, in dem das Nichts zur Nichts- oder Niemandsrose wird:
Psalm
niemand bespricht unsern Staub.
Niemand
Gelobt seist du, Niemand.
Dir zulieb wollen
wir blühn.
Dir
entgegen.
Ein Nichts
waren wir, sind wir, werden
wir bleiben, blühend:
die Nichts-, die
Niemandsrose.
Wieder entdeckte Freiheit
Der Begriff von der »wieder entdeckten Freiheit« setzt voraus, dass Freiheit vergessen werden kann – oder um im anderen Begriff des Vortrags zu bleiben – Freiheit kann verloren gehen. Demgemäß sind mir auch die Bilder von Franz Schuck näher, die ursprünglich von Künstlern hergestellt worden sind, die ihre Motive bewusst »freiheitlich« oder im Sinne eines Impetus für die Freiheit gemeint haben: Otto Dix, Gustav Klimt oder Jacques-Louis David. Hier kann ich nur rufen – »mehr davon«!
Das Thema der wieder entdeckten Freiheit möchte ich mit einem Zitat des Philosophen Boris Groys eröffnen:
»Die […] Philosophen oder Künstler haben erst einen Raum geschaffen – oder zumindest durch ihre Bilder oder ihre Bücher möbliert -, in den ich etwas stellen kann, dem ich Unsterblichkeit, Ewigkeit wünsche. […] Ich treffe eine Entscheidung, ich bekenne mich zu einer Idee, zu einem Bild – ich übernehme eine persönliche Verantwortung für sie. Ich sage, dass es mein Bild, meine Idee ist – und zwar unabhängig davon, ob ich dieses Bild oder diese Idee »selbst erfunden« habe oder nicht. Und dann versuche ich, diesem Bild oder dieser Idee treu zu bleiben – sie gegen alle Verrate, Anfeindungen und Zweifel zu verteidigen. […] Die lebendige Geschichte eines Kampfes um ein Bekenntnis wird erst durch einen Gestus eröffnet, der nicht dem Leben, sondern der Unsterblichkeit, der Ewigkeit, den Toten gilt. […] Durch diesen Gestus entsagt man dem Leben, das ein permanentes Werden, eine Veränderung, ein Wechsel ist, […].« [Boris Groys, Politik der Unsterblichkeit, München 2002, S. 73f].
Dieses Wort von Boris Groys über den Gestus, der dem Bekenntnis vorausgeht und mehr der eigenen und generellen Unsterblichkeit gelten soll, befremdet. Kann alle Ideen-Anhängerschaft diesem Gestus zugeordnet werden? Egal ob Christentum, Kommunismus oder Neoliberalismus? Wie steht es um den Anarchismus, um diejenigen, die für die Idee der Freiheit eintreten?
Dass Anhängerschaft die Gefahr der Behaglich- und Bequemlichkeit birgt, ist altbekannt. Die Ja-Sagerei beginnt oder endet dort, wo das Bier und der Sessel wichtiger werden als der Impetus der Suche, wo eine ursprüngliche Idee von der eigenen Nestwärme der Anhänger erdrückt wird. Zugehörigkeit kann entsprechend sowohl stark als auch schwach machen. Der Zughörige fühlt sich stark durch die Gemeinschaft, die mit ihm eine Idee oder eine Meinung teilt, die durch die Gemeinschaft immer größere Kreise ziehen kann. Gleichzeitig schwächt die Gemeinschaft die Idee eines Zugehörigen, indem jede Einzelmeinung Teil eines Kompromisses sein muss ohne den keine Gemeinschaft bestehen kann. In diese Gedanken haben Erinnerungen an Erlebnisse Platz wie wir sie alle kennen. Momente, in denen wir – um nicht ausgegrenzt zu werden – mitgelacht haben obwohl es uns gar nicht zum Lachen zumute war oder in denen wir andere beschimpft haben, die nicht die reine Lehre lebten wie wir sie für richtig hielten. Von der Zugehörigkeit zur Ausgrenzung ist es oft nur ein kleiner Schritt. Diese Mahnung hat Groys vor Augen, wenn er davon schreibt wie schnell wir Menschen dem Sog der Anhängerschaft – der immer auch Teil und Schicksal unserer genetischen Bestimmung ist – , dem Sog des Absoluten anheim fallen können. Es ist richtig davor zu warnen und auch die Implikationen aufzuzeigen, die im Gestus hin zu einem Bekenntnis liegen können. Es ist allerdings fragwürdig, sich dem Fatalismus und den Relativismus hinzugeben und den Teufelskreis einer Ideen-Findung grundsätzlich aufzugeben bzw. abzulehnen – wie es in den Zeilen von Boris Groys anklingt. Das Wissen um diesen Teufelskreis kann befreien – oder um in einem Bild von Giordano Bruno zu bleiben: der Jäger, der selbst zum Gejagten wird, kennt beide Perspektiven. Nur wer beide Perspektiven kennt, kann den gordischen Knoten durchschneiden und sich zu einer Idee bekennen – ohne von der Idee oder der Anhängerschaft erwürgt zu werden.
Die Freiheit als die Idee von der Selbstbestimmung und von der Autonomie und Würde des Menschen ist eine hohe Herausforderung, die permanent bedroht ist. Manchmal ist die Bedrohung sehr plastisch und konkret wie derzeit im sudanesischen Darfur oder in den Straßen von Bagdad. Manchmal ist die Bedrohung sehr subtil – und ist fast nicht zu entdecken, wie uns die schleichende Entmündigung in einer nach Konsum und Rausch hetzenden Alltagswelt vor Augen führt. Freiheit kann in beiden Fällen »verloren gehen«. Wie aber kann Freiheit »wieder entdeckt werden«?
Freie, Anarchisten und Libertäre haben – um es theatralisch zu sagen – ihr Banner unter der Idee der Freiheit entrollt. Sie tun dies selten als Organisation oder als feste Bewegung. In der Regel agieren sie als Einzelne, die im Kampf für ihre eigenen Rechte und Freiheiten Verbindungen mit Gleich- oder Ähnlichgesinnten suchen. Sobald aus dieser Verbindung der Mief der Ideologie oder der Gleichschaltung aufsteigt, ziehen sie weiter. Sie sind die ewigen Utopisten ohne dabei naiv oder realitätsfern zu sein. Nicht von ungefähr werden sie beispielsweise von den Staatssozialisten und anderen Besserwissern verlacht, die nach den historischen Erfolgen der Anarchie fragen, die nach Systemen suchen, in denen Freiheit oder Anarchie »bewiesen« worden ist. Es gibt weder diese Systeme noch gibt es Staaten, die sich anarchisch oder anarchistisch nennen. Die Nichtvorhandenheit dieser »Dinge« belegt die Stärke der Anarchie. Sie ist die Ausnahme, die sich dem Schema von Boris Groys entzieht. Sie hat weder eine Kirche gebaut noch ein anderes Joch über ihre Anhängerschaft gespannt.
Um im Bild des Eingangszitats von Boris Groys zu bleiben und es aufzulösen: Anarchisten sind Menschen, die sich bewusst der Idee der Freiheit anschließen und selbiger zur Durchsetzung, zur Unsterblichkeit verhelfen wollen. Indem sie allerdings ihre Mittel nicht dem Ziel um jeden Preis unterordnen, sind sie der Gefahr ledig, von ihrer eigenen permanenten Revolte gefressen zu werden oder sich dem Leben zu entfremden. Es gibt kein Erreichtes bei dem sie bleibend verweilen können. Aber sie hetzen und jagen auch nicht auf der Suche nach der Freiheit. Sie sind weder Jäger noch Gejagte – viel zu genau spüren sie, dass ein gewaltvolles Zupacken ihre eigene Idee ad absurdum führen würde. Ihre Genügsamkeit feit sie vor der Käuflichkeit. Sie wissen, dass kein Amt, keine Behörde und keine Pension der Freiheit dienlich ist.
Das zugegebenermaßen sehr ideale Bild, das ich hier von Anarchisten oder Freien zu zeichnen versuche, kann durch viele Beispiele, in denen Anarchisten und libertäre Gruppen fehl getreten sind in Frage gestellt werden. Die Liste der Verfehlungen von kleinen und großen Anarchisten ist lang und ist es wert zur Verhinderung etwaiger Säulenheiliger genauer und kontextbezogen betrachtet zu werden. Dafür ist hier nicht der Rahmen. Man mag auch einwenden, dass das Ideal der Anarchie den Idealen anderer Grund- und Lebenshaltungen gar nicht so fern steht. Was befähigt Anarchisten zu mehr Konsequenz und Toleranz und weniger Gehorsam als beispielsweise Christen oder Kommunisten? Natürlich sind die Antworten auf solche Fragen komplex und im Sinne des Wortes mehrdimensional. Ich bezweifle auch dass am Denken selbst dafür ein wissenschaftlicher Beweis geliefert werden kann. Nachprüfbare Belege bietet aber die Geschichte der Anarchie und die Geschichte der Anarchisten. In der Auseinandersetzung mit Leben und Werk von Freiheitssuchern wie Michal Bakunin, Peter Kropotkin, Gustav Landauer, Max Nettlau, Erich Mühsam und anderen vielen, lässt sich in einem sehr umfassenden Sinn verstehen, warum Libertäre so wenig anfällig für Korpsgeist, Repression und Ideenverrat sind. Das idealtypische Bild, das ich zu zeichnen versucht habe, wollte eines vermitteln: es gibt Ideen, denen sich anvertraut werden kann. Es gibt eine »schaffende Lust«, die immer wieder neu das Überkommene zerstören oder entlarven muss ohne dabei selbst von der eigenen Energie aufgesaugt zu werden und sich zu erschöpfen. Freiheit kann zu allen Zeiten und an allen Orten »verloren gehen«. Sie kann aber auch an allen Orten und zu allen Zeiten neu gefunden und gerufen werden. Sie ist Reise und Ankunft und Weiterfahrt in einem. Die Idee der Anarchie ist für jede Generation mehr als nur eine Reise wert. Sie ist ein nie endendes Rufen und Locken und ein Impetus für alle diejenigen, die nicht nur auf bessere Zeiten hoffen wollen, sondern diese auch gestalten wollen.
Ich habe meine Ausführungen mit Bakunin begonnen und möchte mit Bakunin schließen, indem ich aus dem Nachruf »Über Michael Bakunin« von Gustav Landauer folgende Anregung zitiere, die obschon sie 1901 formuliert worden ist, auch heute noch sehr aktuell ist:
»Die Zeit der Tat wurde abgelöst von der Zeit der Geschäftigkeit. […] Was Bakunin und seine Zeit vielleicht etwas vernachlässigt haben, das wird an allen Enden betrieben: es wird gebaut. Es ist notwendig zu bauen, wer wollte es leugnen; es ist aber nebenbei auch so bequem und so ungefährlich, und bietet so viele Schutzhütten für die kleinen Verlaufenen, die irgendwo unterkommen müssen. Es wird gebaut, aber ohne schaffende Lust. Unsere Zeit will nichts davon wissen, dass man groß bauen muss, und dass die großen Baumeister auch immer die großen Zerstörer gewesen sind.« [zit. nach G. L., Zeit und Geist, hrsg. von R. Kauffeldt u. M. Matzigkeit, 1997 München, S. 102]