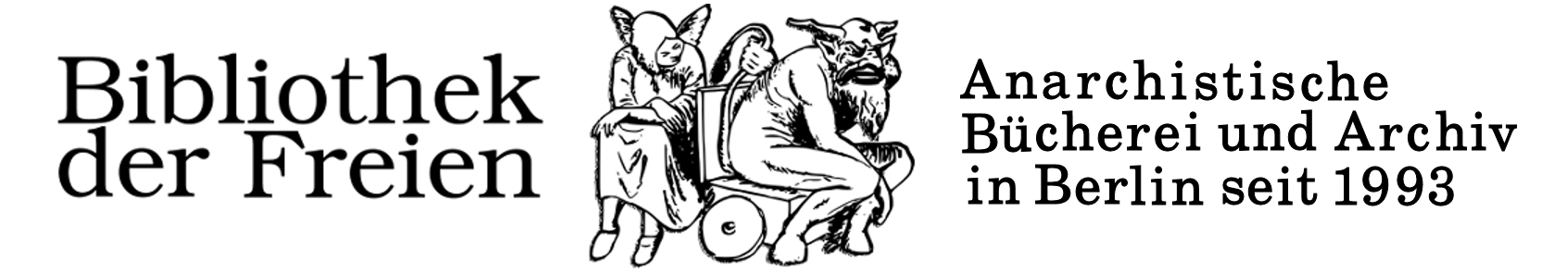Vier unkontrollierte Stellungnahmen zu Anarchie und Liebe
Eine Veranstaltung in der Bibliothek der Freien am Freitag, 2. Dezember 2005 [ Ankündigung ]
1. Beitrag
Die Liebe ist sowieso frei. Auch dann, wenn zwei Liebespartner heiraten.
In der Antike gab es Fürsten und Könige, die viele Frauen hatten. Sklaven und Männer in Arbeitsbrigaden hatten oft überhaupt keine. Das Patriarchat führte die Monogamie ein, um die Vielweiberei der Herrschaften zu beenden. Dabei hat das Patriarchat die Frauen völlig entmündigt.
Noch früher gab es Stammesgesellschaften, in denen die Frauen die Männer verstoßen konnten, wenn sie keine Lust mehr hatten.
Die Monogamie ist eine kulturelle Abmachung, sie ist nicht Natur!
Ich bin eifersüchtig, aber ich lebe meine Eifersucht nicht aus. Mir ist das zu blöd Drohungen auszustoßen oder mich zu prügeln. Wenn sie einen anderen will, soll sie ihn nehmen. Wenn es sich nur um Machtspielchen handelt, ist die Liebe nicht frei. Das kann so leben wer will, aber sie sollen mich in Ruhe lassen mit ihren Neurosen.
Viele Ehen werden geschieden, viele Paare sind nur Paare auf Zeit. Das mag verschiedene Ursachen haben, Illusionen, Machtdünkel, aber auch der bedrückende Alltag.
Wenn nicht alles frei ist, kann die Liebe auch nicht frei sein. Dieses Problem ist individuell oder paarweise nicht zu lösen. Die einzige Möglichkeit besteht darin, dass alles mit Lust und Liebe gemacht wird.
Die Liebe ist ihrem Wesen nach kein Opfer. Die aufopfernde Liebe soll leben, wer will, aber sie sollen mich mit ihren Neurosen in Ruhe lassen. Natürlich ist Solidarität auch unter Liebenden nötig, aber das ist nicht der Kern der Liebe. Viele Menschen, die sich aufopfern, können das gar nicht durchhalten. Sie werden bitter oder sagen, jetzt will ich was haben für mein Opfer – sie zwingen einen Tausch auf.
Die Liebe ist kein Deal nach dem Motto: Liebst du mich, lieb ich dich. Die Liebe kann auch entstehen, sich entwickeln, aber nicht so, wie ein expandierender Familienbetrieb.
Ökonomische Unabhängigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für die frei Liebe. Klassisch: er arbeitet und sie macht den Haushalt, wie in den 50er Jahren. Ob die Einstellung der Liebenden diese epochenbedingte Rollenverteilung innerlich sprengen konnte – ich glaube es nicht.
Treue zu brechen ist keine Freiheitsberaubung. Treu ist man aus Neigung, aus Verpflichtung, Kalkül oder Angst ist man abhängig. Ich bin nicht für Treue oder Untreue als Selbstzweck – aber ich bin für die Neigung. Hier definiert sich die Freiheit positiv, im Sinn eigener Bedürfnisse der Neigung, obwohl der oder die Verlassene vielleicht tief gekränkt werden. So etwas kann es immer geben.
Ich kann mir Sexualität ohne Liebe vorstellen, nicht aber Liebe ohne Sexualität – das ist Romantik. Sexualität ohne Liebe muss man nicht verurteilen, mir würde allerdings etwas fehlen, sowie mir ein schönes Zitat zum Schluss fehlt.
2. Beitrag
Die Frage nach Anarchie und Liebe hat in dieser Woche [2.12.2005] sogar einen aktuellen Bezug, nachdem nämlich die CDU-Vorsitzende erklärte, sie wolle »mehr Freiheit wagen«, und der SPD-Vorsitzende antwortete, man solle auch »mehr Miteinander wagen«. Da haben wir schon das ganze Problem: bedeutet Freiheit nicht auch Gleichgültigkeit und Gegeneinander? Bedeutet Miteinander nicht auch Enge und Bevormundung?
Ich denke, ein Grund, warum die Idee der Anarchie im allgemeinen nicht sehr geschätzt wird, liegt gerade darin, dass Anarchie als Zerstörung des Dauerhaften, als Unzuverlässigkeit, als Verfall von Bindungen usw. gedacht wird. Die Menschen hängen am Staat, nicht weil er Bajonette und Schulden hat, sondern weil er eine Verkörperung der Liebe ist. Der Staat ist das gemeinsame Haus, das bergende Dach über uns allen. Das wussten die Fürsten, die allergnädigsten, im allgemeinen besser als die republikanischen Politiker, aber zum Beispiel Schröder in Grimma, in Gummistiefeln, bleibt unvergesslich, weil er das Gesicht des Liebenden zeigte, der mit dem Leid der Landsleute fühlte. Wenn der Staat erst weg ist, wer liebt uns dann noch so?
Die meisten Menschen, will ich einmal annehmen, sind sehr wohl zu freiwilliger Solidarität und Fürsorge bereit. Und nicht nur bereit: für andere da zu sein, ist für sehr viele Menschen sogar der wichtigste Lebenszweck, sie tun es nicht, weil sie finden, sie sollten, sondern frei von sich aus. Für den praktischen Zweck, der mit diesen Werten verbunden ist, nämlich den Schwachen und Notleidenden zu helfen, dürfte jedenfalls immer genug freiwillige Solidarität vorhanden sein. Was aber mit den Leuten, die davon nichts wissen wollen, den harten geizigen Egoisten? Muss man sich im Sinne der Freiheit damit begnügen, sie zu kritisieren und zu verachten? Oder ist es legitim, sie zu Beiträgen für das Wohl anderer zu zwingen? Der amerikanische Philosoph Robert Nozick begründete die Abwendung von seiner früheren libertären Position gerade damit. »Gemeinschaftliche Ziele, die die Regierung völlig ignoriert, scheinen tendenziell unserer gemeinschaftlichen Aufmerksamkeit nicht würdig zu sein und sie daher wenig zu empfangen.« Zu solchen Zielen müsse aber auch Fürsorge und Solidarität für die Schwachen gehören. Warum aber keine Beschränkung auf freiwillige Beiträge? Dies würde »nicht die feierliche Kundgabe und symbolische Bekräftigung der Gesellschaft für die Wichtigkeit und den zentralen Charakter dieser Bindungen von Fürsorge und Solidarität darstellen.« Hier müsse im Namen des Ganzen gehandelt werden. Nur dann könne man sich mit der Gesellschaft identifizieren, ohne sich für ihre Kaltherzigkeit schämen zu müssen. »Wenn irgendwelche Anarchisten moralische Einwände dagegen hätten, sich überhaupt am Staat zu beteiligen, könnten wir ihnen gestatten, 5% mehr als die Steuer, die sie sonst zu zahlen hätten, an eine private Wohlfahrtseinrichtung abzuführen, die sie sich aus einer Liste aussuchen könnten.« Soweit Nozick 1989. *
Es scheint also so zu sein: Das autoritäre Denken nimmt den öffentlichen Zwang in Kauf, um dem Wert der Verbundenheit zu äußerster Geltung zu verhelfen. Das libertäre Denken setzt die Freiheit an die Spitze der Werte, und nimmt in Kauf, dass dann so viel Verbundenheit da ist, wie eben nun mal da ist, sei es viel oder wenig.
Dennoch glaube ich nicht, dass der Gedanke richtig ist, Anarchie und Liebe in dieser Weise gegeneinander abzuwägen, und zwar deshalb nicht, weil Verbundenheit ihrem Wesen nach freiwillig ist. In einer Gesellschaft, in der zum Beispiel alle Steuern für die sozial Schwachen bezahlen müssen, wird es weniger solidarische Empfindungen geben, als in einer Gesellschaft, in der solche Empfindungen die alleinige Ursache für Hilfeleistungen sind. »Darum soll der Staat sich kümmern,« sagt man sich, »wofür zahle ich die ganzen Steuern denn? Andere zahlen viel weniger.« Usw.
Werde ich zu etwas gezwungen, fühle ich hauptsächlich den Zwang und setze mich mit ihm auseinander, etwa durch Gehorsam oder Flucht oder Rebellion. Wenn die Menschen zur Solidarität gezwungen werden, um diese symbolisch als zentralen Wert zu bekräftigen, wird eben durch den Zwang das Solidaritätsgefühl ausgehöhlt. Symbol und Wertempfinden treten allmählich auseinander, das eine wird zur Phrase, das andere Zynismus. Kritisch wird es dann, wenn alle Leute allen die solidarischen Gefühle absprechen und nach dem Staat rufen. Der Zwang untergräbt dasjenige, was er schützen soll.
Nozick erklärt, wenn man Lieblosigkeit durchgehen läßt, wird die Liebe als zentraler Wert beeinträchtigt, und daher braucht es den Zwang. Umgekehrt gilt, wenn Leute zu dem Verhalten gezwungen werden, das ihnen besser die Liebe nahelegen sollte, dann wird die Liebe ebenfalls beschädigt, weil es ohne Freiheit keine Bindung gibt. Scheint so, als könnten wir für die Liebe wenig tun. Was sie betrifft, lieben wir am besten einfach drauflos, ohne uns um Staat und Anarchie, um Steuern und Egoisten besonders zu bekümmern. Und wenn sowohl der öffentliche Zwang als auch die Freiheit der Liebe schaden, optiere ich vorsichtshalber für die Freiheit.
* Robert Nozick, Vom richtigen, guten und glücklichen Leben, Hanser Verlag, München Wien 1991, S. 319 ff.. Orig.: The Examined Life. Philosophical Meditations, Simon & Schuster, New York 1989.
3. Beitrag
Nach mehrwöchiger Untersuchungshaft wurde im Juni 1910 vor dem Münchener Amtsgericht ein Prozeß gegen Erich Mühsam [1878-1934] und einige seiner Mitstreiter aus der ein Jahr zuvor gegründeten »Gruppe Tat« eröffnet. Die Anklage auf »Geheimbündelei« richtete sich insbesondere gegen Mühsams Bemühungen, die sozial ausgestoßenen und gesellschaftlich geächteten Angehörigen des sog. »Lumpenproletariats« in sozialrevolutionärem Sinne zu aktivieren – ein für die Staatsanwaltschaft nicht nur politisch, sondern offensichtlich auch moralisch höchst verwerfliches Ansinnen.
Eine für den Prozeßverlauf, der im übrigen für alle Angeklagten mit einem Freispruch endete, höchst charakteristische Szene schildert Mühsam rückblickend wie folgt: Die Staatsanwaltschaft »hatte den ganzen Prozeß hindurch darauf verzichtet, an irgendeinen Zeugen Fragen zu richten, bis schließlich eine Dame vernommen wurde, eine Juristin aus der Schweiz, die meine Ideen teilt und mich bei der Propaganda unter dem ›fünften Stand‹ tätig unterstützt hatte. So hatte sie einmal bei einer Zusammenkunft, zu der wir eine Anzahl Prostituierte geladen hatten, eine Ansprache gehalten. Als sie nun gefragt wurde, welche Gründe sie dazu bewogen hätten, und als ihre Antwort darauf so warmherzig und so schön geklungen hatte, daß die Anklage auch ihren letzten moralischen Halt zu verlieren drohte, da griff endlich der Staatsanwalt mit der unvermittelten Frage ein: ›Sie huldigen aber doch der freien Liebe?‹ – meine Kameradin sah den Mann groß an und erwiderte dann, indem sie jedes Wort betonte: ›Ich glaube, Liebe kann gar nicht unfrei sein.‹ Es war das einzige Mal, daß ich in einem deutschen Gerichtssaale erlebte, daß das Publikum auf eine Zeugenaussage Beifall klatschte, ohne daß der Verhandlungsleiter es gerügt hätte.«1
Offensichtlich ließ sich mit derartigen Stellungnahmen innerhalb der anarchistischen Bewegung seit jeher große und in weiten Teilen begeisterte Zustimmung erzielen. Gleichwohl sollte die absolute Ineinssetzung von Liebe und Freiheit meiner Meinung nach allenfalls sehr vorsichtig als stets gefährdetes und immer wieder neu zu erringendes Ideal postuliert werden. Sobald sie als apodiktische Propagandaformel daherkommt, birgt sie erhebliche Fallstricke lebenspraktischer Art in sich. Im Gegensatz zur emanzipatorischen Intention drohen diese im schlechtesten Fall sogar das konkrete Miteinander der hier und jetzt Liebenden zur Illustration doktrinärer Formeln zu erniedrigen.
Natürlich kann Liebe auch unfrei sein! Selbst beim besten Willen können sich auch in die gleichberechtigsten Liebesbeziehungen immer wieder aufs neue Formen des Machtspiels, des in Eifersuchtsszenen explodierenden Besitzstrebens, der mehr oder weniger freiwilligen Knechtschaft, der Ausbeutung und wechselseitigen Instrumentalisierung einschleichen und verfestigen. Dieser Tatbestand läßt sich übrigens auch an den Biographien namhafter Anarchisten und Anarchistinnen ablesen. Ebenso drängt er sich durch eine nüchterne und selbstkritische Betrachtung des eigenen Liebeslebens auf. Den sozialpsychologischen Hintergrund hat Emma Goldman [1869-1940] vermutlich sehr hellsichtig umrissen. Sie erblickte in der Liebe als der tätigen Anerkennung jedes Individuums um seiner selbst willen das schwächste und zugleich stärkste Bindeglied zwischen allen Menschen. Und weil der Mensch ihrer so dringend bedarf, macht ihn diese Sehnsucht verwundbar.2
Freiheitliche Liebesbeziehungen setzen daher zu allererst den erklärten und handlungsbereiten Willen der jeweils Beteiligten zu einem egalitären Miteinander und ihre Behauptungsfähigkeit im Sinne individueller Integrität voraus. Nur unter dieser Voraussetzung kann die Liebe überhaupt eine potentielle Vorwegnahme der Anarchie auf sozialer Mikroebene sein – mit allen Potentialen, aber auch mit allen Schwierigkeiten.
Gemäß des ihr zugrunde liegenden Prinzips der Herrschaftslosigkeit ließe sich Anarchie als vielgestaltige und dynamische Form gesellschaftlichen Verkehrs beschreiben. Ebenso müßte auch die Freiheit in Liebesdingen für jedes Individuum die Möglichkeit beinhalten, unbeschadet von materiellen Abhängigkeiten und sittlich-moralischen Vorschriften jederzeit das Milieu aufzusuchen, in dem es für sich am befriedigensten seine Liebe leben kann. Ideologische Anmaßungen wie der Zwang zur kirchlich-staatlichen Beglaubigung lassen die Liebe ebenso schablonenhaft erstarren, wie etwa der als subkulturelle Leitlinie propagierte Nach-68iger-Männer-Spruch: »Wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment.«
Ob Promiskuität oder Monogamie, ob homo-, hetero-, autosexuell oder platonisch, ob Ehe, informelle Partnerschaft oder Single, ob Familie oder kinderlos – keiner dieser oder anderer Formen von Liebesbeziehungen gebührt ein Vorrecht vor anderen. Für welche Möglichkeit sich die einzelnen entscheiden, sollte allein ihrer souveränen Wahl, ihrer selbst- und fremdverantwortlichen Experimentierfreudigkeit überlassen sein. Wie schon der Titel der heutigen Veranstaltung besagt: »Liebe kennt kein Gebot«.
Ein weitgehender gesellschaftlicher Konsens hierüber schiene mir noch am ehesten die Gewähr für ihre auch nur annähernd freie Entfaltung zu bieten. Ergänzt werden müßte er auf individueller Ebene durch die aktive Bereitschaft, nach eingetretenen Stagnationen immer wieder den Neugewinn authentischer Beziehungen anzustrengen.
In diesem Sinne möchte ich keinesfalls sagen »Liebe kann gar nicht unfrei sein«. Mein Credo lautet vielmehr: »Liebe soll frei sein!«
1 Erich Mühsam: »Mein Geheimbund«, in: Ders.: »Ich bin verdammt zu warten in einem Bürgergarten. Band 2. Literarische und politische Aufsätze«, hrsgg. von Wolfgang Haug. [Herrmann Luchterhand Verlag] Darmstadt und Neuwied 1983, S. 89.
2 Vgl.: Candace Falk: Liebe und Anarchie &Emma Goldman. Ein erotischer Briefwechsel. Eine Biographie. [Karin Kramer Verlag] Berlin 1987, S. 103.